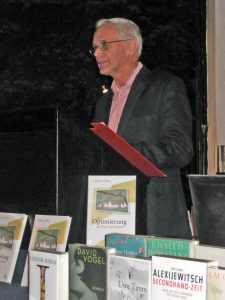
Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, ein paar von meinen Versen zu hören!
Besonders danken möchte ich Herrn Professor Behrmann, verdanke ich ihm doch die gründlich-sten Erkenntnisse darüber, was Lyrik im Allgemeinen und die moderne Lyrik im Besonderen ist und vermag.
Und ich freue mich auch, dass Herr Rhode, mein langjähriger Oberhirte, trotz mancher Schwierigkeiten hierher gekommen ist; hat er doch dankenswerterweise stets ein hochherziges Verständnis dafür gehabt, dass ich nicht immer nur habe Schafe hüten wollen.
Zu danken habe ich aber auch und vor allem Herrn Homes und Frau Dr. Knackstedt, ohne deren Anstoß und aufopferungsvolle Arbeit dieser Gedichtband nicht erschienen wäre.
Mein Dank gilt auch Herrn Elsmann, der mir eine seiner wunderbaren Fotografien für die Umschlaggestaltung großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat.
Und zu danken habe ich ebenfalls Frau Kowarsch vom Frieling-Verlag, dass sie das Erscheinen dieses Bandes so sorgfältig, geduldig und freundlich begleitet hat.
Schließlich danke ich auch Ihnen, Frau Liublina und Herr Loch, dass Sie die Pforten Ihres Hauses für diese Veranstaltung so bereitwillig geöffnet haben – eine Veranstaltung ja auch, in gewissem Sinn, durchaus prekärer Natur.
So hat Brecht einmal gesagt, bei Gedichten sei jedes der Feind des anderen, d.h. ein jedes beansprucht einen eigenen Raum um sich herum – in einem Buch etwa eine eigene Seite – und vor allem auch auch seine eigene Zeit, damit es sich entfalten kann. Kein Wunder also, dass es nur wenige Gedichttypen gibt, die für einen Vortrag en suite geeignet sind, am ehesten vielleicht Balladen und neuerdings natürlich die Slam-Poetry. Lyrik im engeren Sinne, so wie sie sich bei uns als Erlebnisgedicht herausgebildet hat, dagegen schon weniger, und moderne Lyrik, also jener Typus, der sich in der Tradition der sog. klassischen Moderne eines Pound oder Eliot bewegt (und der Sie jetzt gleich erwartet), der nun schon gar nicht.
Der Grund dafür ist ebenso bekannt wie einfach: Diese moderne Lyrik ist nicht leicht zugänglich. Das trifft zwar auf vieles andere in der modernen Kunst ebenfalls zu; aber der Dichtung verzeiht man es am wenigsten. Denn – im Unterschied etwa zu Malerei und Musik – arbeitet sie ja mit einem Material, das jeder von uns täglich gebraucht, und zwar zur Verständigung – und das erscheint nun plötzlich im Modus der Unverständlichkeit!
Warum das? Ein Grund dafür ist zweifellos die viel berufene Komplexität der modernen Welt selbst, deren authentischer Ausdruck diese moderne Kunst und eben auch die moderne Lyrik ja sein will. Sie wissen doch: Vom Mobiltelefon in unserer Hand bis zum Quasar XY am Rand des Weltraums, von der Bezirksversammlung der Grünen bis hin zum Banken-Crash sind wir von Dingen und Vorgängen umgeben, die wir nur ansatzweise verstehen. Wir sind, nolentes volentes, Mitspieler in einem Spiel, von dem wir, wenn wir uns ehrlich Rechenschaft geben, nur sehr wenig begreifen.
Nun hat diese schwierige Zugänglichkeit aber auch, wie schon oft bemerkt worden ist, ihr Gutes: Sie stellt nämlich Stacheln auf gegen eiliges Konsumieren, vor allem jedoch bringt sie das künstlerische Material als solches und für sich selbst in Stellung: in der Dichtung also die Sprache, ihren Klang und ihre Bilder. Die können nun nämlich gewissermaßen ein Reich eigenen Rechts errichten, in dem sie nicht mehr zu bloßen Eilboten einer Information degradiert sind und nach getaner Schuldigkeit sogleich wieder entlassen werden. Wer sich bei den gelungenen Exemplaren dieses Typus also nur dem Wort, dem Klang und den Bildern öffnet, kann daher eine im reinsten Sinn poetische Welt erfahren.
Trotzdem aber verzichtet auch das moderne Gedicht nur selten vollständig auf so etwas wie ein Sinn-Substrat. Es will allerdings, dass wir, mit Valéry zu sprechen, einen Teil des poetischen Vergnügens uns selbst verdanken – durch ein wenig Kopfarbeit nämlich. Dann erst will es uns wie die Jerichorose, wenn wir ihr graubraun dürres Kraut lange genug geduldig gewässert haben, irgendwann die Farbe seiner inneren Wahrheit offenbaren. Leider allerdings eine Farbe, die selten oder nie eindeutig zu definieren ist. Und so eröffnet es uns stets, neben einer Reihe gangbarer, auch mindestens ebenso viele Holzwege zu seiner Deutung; u.U. begegnen wir dann , wie in einem Spiegelkabinett, immer wieder nur uns selbst. Unumgänglich also Geduld und Einfühlung; robuster Zugriff dagegen macht die Botschaft unleserlich; das ist dann, wie wenn Sie das Stemmeisen auf ein Rubbellos ansetzen – und schon ist sie futsch,die Mittelmeerkreuzfahrt!
Sie können jetzt natürlich sagen: Wozu mit der Kirche ums Dorf? Es gibt doch auch einfache Verse. Und Sie könnten einem Dichter wie Valéry empfehlen, es doch lieber damit zu versuchen. Schreibt sich schneller, liest sich leichter und verkauft sich besser. Jaja, würde er antworten, ich würde vielleicht ganz gerne. Nur: Wenn Sie wirklich aufs Dichten sich einlassen, steht Ihnen der Stil, in dem Sie sich authentisch ausdrücken können, fatalerweise nicht frei. Es ist dann Ihr höchst eigener Sprachgeist selbst, der die Regie übernimmt, und Sie selbst sind in eine wesentlich passive Rolle verwiesen, bestenfalls Co-Pilot, meist aber nur Tandemsitz, und zwar hinten.
Doch ich verschwatze mich, und Sie sind hier, um Gedichte zu hören. Fangen wir also endlich an! Insgesamt werden es 18 sein; ich werde aber nach dem neunten 10 Minuten Pause machen. Wer den Gedichtband zufällig besitzt und es möchte, soll gern mitlesen; ich werde jeweils die Seitenzahl ansagen. In jedem Fall werde ich den Umfang des jeweiligen Gedichts vorher skizzieren; meiner Erfahrung nach fällt das Aufnehmen dann leichter. Die ersten drei Gedichte finden Sie im ersten Zyklus, d.h. unter den Sechs vorbeugenden Selbstexplikationen, einem, wie der Titel schon andeutet, poetologischen Zyklus:
Fühlsache
Roadmoving
Rose von Jericho
Sylphen, Tamerlan und Kojimas Kassiber – allzu entlegen? Nicht doch! Frag nach bei Homer! Schon unser Ur-Barde ließ so mancherlei treiben im Strom seines hochtönenden Sanges, was seinen Zuhörern allenfalls ahnungsweise verständlich war. Aber: Es klang eben gut! Vielleicht gerade deswegen. So ist denn, wie figura zeigt, die Brücke zwischen Dichter und Publikum seit eh und je schadhaft gewesen; und das ist wohl sogar noch der günstigere Fall, verglichen mit unserer Alltagsdiskurswelt, wo Kommunikation nicht einmal mehr Bröckelbrücke ist, sondern – siehe Watzlawick – meist nur noch Absturz vom Hochseil.
Da kann selbst die Technik nicht helfen, die doch sonst alles so leicht macht und einfach, im Gegenteil: Sie kreiert sogar noch neue Absturzfiguren: Telefonieren Sie mal! Wie viele Missverständnisse allein schon deshalb, weil Sie das Mienenspiel am anderen Ende nicht sehen und Spaß für Ernst nehmen und umgekehrt! Und nun erst unser „ Handy“! Da platzen doch immer wieder Anrufe in Situationen, die passen da rein wie das Huhn in den Heringsschwarm! Sagen wir: Direkt aus Verona, direkt aus der Arena, direkt „Aida“, supertoll! auf richtigen Elefanten! – und Sie vielleicht gerade unterwegs zu einer Beerdigung. Oder, weniger spektakulär, ich selbst neulich auf dem Heimweg von einem Urania-Vortrag, „Der Sternenhimmel im Herbst“. Und ich also den Kopf immer noch voll mit Bootes und Aldebaran, mit dem Stier und den Doppelsternen im Schwan, dazu die NGC 1275 und der M1-Nebel und wie all das wild durch den Weltraum wirbelt – und da plötzlich, klingling, will jemand von mir die Details meiner Haftpflichtversicherung bei der HUK Coburg wissen. Oder noch etwas: Denken Sie mal an die Bösartigkeit schalltechnischer Kommunikations-Torpedos: Hi-fi-Stereo, volles Rohr aus dem Off, und jetzt können Sie brüllen wie Stentor, jeder zweite Satz kommt als Songfetzen an. Oder die Minimal-invasiv-Variante: Winzige Lautsprecherknöpfe, die, während Sie reden, dem andern die Ohren verstöpseln (und wenn er langhaarig ist, merken Sie das nicht einmal).
Nun will ich die Elektronik nicht in Bausch und Bogen verteufeln. Hat ja auch ihr Gutes. Z.B. können Menschen, die von räumlich einander getrennt sind, zumal Liebende, dadurch doch trotz allem eine Art Zusammensein erleben. Und mehr noch sogar. Denn irgendwie – fast hätte ich gesagt: sub specie aeternitatis – ist es doch auch ein magisches Faszinosum: diese elektronische Hülle aus potentiellen Lauten und Emotionen rund um den Erdball! Und in regressiven Momenten möchte man beinah gar glauben, es gehört auch eine Art Götter dazu, andere natürlich als die altausgedienten: eine andere Aphrodite, kühler vermutlich, die da aus magnetischen Schäumen als Amplituden-Anadyomene heraussteigt, und ein anderer Apoll, der, falls er überhaupt noch Spanndienste leistet, seinen hohen Funk-Wagen statt mit den bräsigen Musen mit einer Art Blitz-Mädels voll geladen hat. Aber ich merke, ich komme vom Kurs ab; ich fahr mal lieber fort mit Vorlesen.
Unter dem Abendstern
Abendland
Der Westwind bei Taormina
Mit dem letzten Gedicht sind wir, Sie haben es bemerkt, durchs Dickicht der Missverständnisse an den Rand eines Abgrunds gelangt: den zwischen den Generationen. Der fängt schon dort an, wo alles, was diese Jugend tut oder sagt, für ältere Nerven einfach zu laut ist: ob Stereoanlage, E-Gitarre oder gar Mofa – stets halten wir Älteren uns die Ohren zu und fragen uns, ob diese Jüngeren überhaupt welche haben.
Und dann, ach, diese Manieren! Im Bus dieser Eh-Alter-Slang über drei Bänke hinweg, vorm Kino dieses schweißdünstende T-Shirt-Gedrängel, und, hilf Himmel! in Museum oder gar Kirche, falls sie da wirklich einmal hinein müssen, gruppenweise gezwungen, dann versuchen sie wenigstens ihren Döner weiter zu futtern, laut lachend natürlich und beidhändig. Und dort – Museum, Kirche – nun auch noch der Bildungs-Abyssus! Ob Petrus oder die Gotik, ob Dalís zerlaufene Uhren oder Beethovens Klavierkonzerte – eigentlich, denken wir, immer wieder enttäuscht, eigentlich müsste doch jeder, selbst wenn er noch nicht volljährig ist, irgendwann irgendwo schon mal etwas davon gehört haben, auch von den alten Griechen, also Helena, Hektor, Dardanos und, tausendmal doch bedichtet, der Helikon, wo die Musen hocken, oder der Ilion, von wo, tausendmal doch gemalt, dieser lockige Hütebub in Zeus´Adlerfängen aufstieg zum olmypischen Mundschenk. Nichts! Stets Fehlanzeige!
Aber dann, zwischendurch, doch immer mal wieder ein kleines Aufatmen, sieh da, ein Hoffnungsschimmer am silberhaarigen Horizont, wenn irgendwann bei irgendeinem Jungschen wenigstens so etwas wie Erziehung durchscheint: Ein Tätowierter hält uns die Tür auf, ein Gepiercter bietet uns seinen Platz an, ein Irokese hebt uns den Koffer hinauf ins Gepäcknetz. Ah, denken wir dann, noch ist Polen nicht verloren, der könnte doch noch ganz ordentlich werden, eben wie wir.
Andererseits aber wir sind mit dem Erwachsenwerden auch eigen: Zu früh sollen die Jungen, vor allem die Kinder, auch nicht werden wie wir, ob das nun die Sexualität betrifft oder auch anderes, z.B. das Geldmachen: Eine frühreife, allzu gewievte Geschäftstüchtigkeit stört uns, wir denken: Wer mit sechs an der Straßenecke den Teddy und seinen Goldhamster feilbietet, der verhökert mit sechzehn dann im Internet auch seine Großmutter, raffgierig wie der Papst früher die Kardinalshüte oder der Zar damals sein Alaska. Nein, nein, Kinder sollen, so meinen wir, erst einmal richtig Kind sein; und danach sollen sie das normale Programm durchlaufen – d.h. Einschulung, Konfirmation, Abitur, Verlobung und Hochzeit in Weiß, und alles mit den jeweils dafür vorgesehenen Frisuren und Rocklängen, kurzum unser eigenes Programm, immer hübsch Schritt für Schritt von einer Initiation zur nächsten, treu traditionsfixiert – wie unsere indigenen Vettern im Busch. Doch bevor ich mich jetzt selbst noch dorthin verirre, fahre ich lieber mit den Gedichten fort.
Teestubendisput
Nerv und Frequenz
Abverkauf
Pause
Heiliger Organismus der Welt (erinnern Sie sich?), das klingt nach einer Natur, die von Göttern durchwaltet ist – ziemlich fremd, für uns, diese Vorstellung, finden Sie nicht? Aber eine heile Natur, oder doch eine als heil idealisierte, die kennen wir ja auch: drei Wochen Berghütte mit Brunnen und Holzfeuer oder dergleichen. Da grüßt von fern immer noch das gute, antike Arkadien, diese Ideallandschaft mit glücklichen Ziegenhütern, die Tityrus oder Menalcas heißen. Dazu gibt es übrigens seit geraumer Zeit auch eine exotische Variante, etwa als Serengeti oder Ngorugoru-Krater, mit glücklichen Rangern und Guides für Zebras, Elefanten und fotografierende Touris.
Daneben aber ist, gerade heute, Natur auch noch etwas sehr Un-fotogenes, schon weil kaum mehr anschaulich, zumindest nicht unmittelbar. Es ist die Natur, welche die Wissenschaft uns präsentiert, z.B. als Urknall oder Doppelhelix. Erst einmal nichts als bloße Tatsachen-Informationen. Und je detaillierter sie werden, desto unzugänglich-abstrakter. Der Urknall etwa mit seiner „Planckzeit“ und „Ersten Singularität“, oder die Doppelhelix mit „Proteinen“, „Enzymen“ und Chimären wie „Adenin“, „ Thymin“, „Cytosin“ und wie sie sonst noch heißen. Und klein klein weiter aufgedröselt stehen dann überhaupt nur noch Buchstaben und Zahlen für irgendwelche Mikro-Wesenheiten, die in Reagenzgläsern und Petrischalen ihr unromantisches Dasein fristen.
Andererseits haben derlei Tatsachen-Informationen, wenn man sich vom nüchternen Gestus der schieren Faktizität nicht vorschnell abfertigen lässt, auch eine durchaus faszinierende Dimension: Oder soll man für ganz normal, nicht anders zu erwarten und selbstverständlich halten, dass alle für das Leben auf diesem Planeten notwendigen Ingredientien ihm von Supernova-Explosionen gesponsert worden sind ? Oder dass wir, wie wir hier sitzen, ein Milliarden-Verein bewusstlos zuckender Zellen sind, deren Arbeit und Programm – inklusive womöglich der Dichtkunst und ihrer Rezeption – sich unserem Willen vollständig entziehen? Und die, wenn wir an ihnen herummanipulieren – ich erinnere nur an bestimmte Experimente mit weißen Mäusen, Drosophila-Fruchtfliegen oder dem Klonschaf Dolly – wahrhaft horribel ausschlagen können?
Und dabei natürlich auch immer der Verdacht: Man selbst, ist man vielleicht auch nichts anderes als so ein dumpfes Bündel Materie, das nach physikalischen und biologischen Regeln ruckt und zuckt – genau denselben wie die gesamte übrige Welt ringsum? Und soll man das als naturhafte Harmonie ansehen oder als empörenden Anschlag auf den freien Willen und die Menschenwürde? Aber ich soll hier ja nicht Philosophie treiben, sondern Gedichte vorlesen, und damit will ich jetzt fortfahren.
Arkadische Rhapsodie
Fliegen mit AATT
Quappensprung
Rotaugenlaubfrösche und Katzenaugennattern – ohne exotische Zutaten hüpfen und kriechen solche Tiere ja auch bei uns herum. Vorausgesetzt sie finden geeignete Biotope. Doch die werden bekanntlich immer seltener. Sie wissen schon: Umweltzerstörung. Ein Problem, das mir zum ersten Mal mit dem Waldsterben begegnete. Der Wald, Grimmscher Märchenwald und Eichendorffs Waldesrauschen, ist ja für die deutsche Seele geradezu existenziell bedeutsam, ein quasi mythischer Raum. So sehr, dass ich z.B. kahle Landschaften abstoßend finde. Und ich erschrecke, wenn ich erfahre, dass der Mensch selbst es war, der sie kahl geschlagen hat. Island zum Beispiel. Dort gab es reichlich Wald, bis die Wikinger ihn zu Bau- und Feuerholz zerhackten. Und auch wenn man dort heute mit Stein und Stahl baut und mit Erdwärme heizt, also Geothermie, empfinde ich dennoch die kahlen Flächen als mythische Wunde – und blicke mit Sorge auf unsere Wälder.
Bekanntlich sind aber nicht nur die gefährdet. Vor allem sind es ja die Regenwälder. So ging vor einigen Jahren in Kalimantan (bzw. Borneo) so viel davon in Rauch auf, dass wochenlang die Luft über ganz Südostasien grau schwer Qualm von war. Natürlich bemüht man sich allenthalben um Wiederaufforstung, und das sogar mit modernsten wissenschaftlichen und technischen Methoden. Doch leider: Brandstifter arbeiten schneller als Förster.
Und wenn der Wald nachwächst, ist das nächste Problem die Wiederansiedelung seiner Tiere. Die Aborgines hatten es da noch leicht: Sie berührten einfach die in den Fels geritzten Tierbilder, und schon wurden die lebendig (und jagdbar). Wir haben es schwerer. Manche Tiere müssen sogar erst einmal von Menschenhand herangezogen werden, ehe man sie schließlich auswildern kann. Dokumentationen zeigt mitunter das Fernsehen. So vor einiger Zeit eine über den Waldrapp, diesen schwärzlichen, ibisartigen Vogel, der in freier Wildbahn bei uns lange schon ausgerottet ist. Man hat also ein paar Tiere hier künstlich aufgezogen und ihnen dann den Weg über die Alpen in die Toskana gezeigt, ihr altangestammtes Winterquartier. Tatsächlich haben im Jahr darauf dann die meisten selbständig den Rückweg gefunden. Wir aber machen uns jetzt schleunigst auf den Rückweg zur Poesie!
Isländisch Lied
Alang Alang
Auswildern ultraleicht
Immer wieder faszinierend, nicht wahr, das Phänomen des Vogelzugs – diese fabelhafte Orientierung im Raum, und dann dieses Zeitprogramm: Naturzeit. In reiner Form erleben wir die fast nur noch im Urlaub: die Sonne, die jeden Tag zur selben Zeit (oder doch fast zur selben) über dem Meer oder hinter einem Berg als Feuerball auf- oder untergeht, ein Hahn, der jeden Morgen zur selben Zeit loslegt, oder auch kleine Fledermausdrachen, die jeden Abend zur selben Zeit auf Beute ausfliegen. In sich konsistente Abläufe, weder zu verlangsamen noch zu beschleunigen. Das hat etwas Erholsames. Denn unsere Zivilisationszeit, gewissermaßen elastisch, wie sie ist, treibt uns ja, zumindest tendentiell, stets zur Beschleunigung an und setzt uns damit ja auch fortgesetzt unter Stress.
Natürlich haben wir zwischendurch auch entspannte Augenblicke. Dann entschließen wir uns zu einer gemächlicheren Gangart. Und manchmal sogar so entspannte, dass wir uns über die Zeit als solche grundsätzlich erheben. Dann sehen wir Zeit vielleicht philosophisch: als bloße Denkkategorie. Oder naturwissenschaftlich: als kosmisch raumrelationiert. Oder mit Buddha und den Mystikern als Schleier der Maya, schieren Augentrug, der den Blick auf das Absolute trübt.
Doch eine solche Sicht ständig durchzuhalten, fällt schwer, vor allem bei außergewöhnlichen Ereignissen, wo die Zeit sich dann doch auf einmal sehr real geltend macht. Dazu gehört besonders der Tod. Ja, angesichts bestimmter Schreckensszenarien empfinden wir es sogar als moralisch fragwürdig, uns mit Betrachtungen über die Unwirklichkeit des Phänomens Zeit zu beruhigen: Auschwitz etwa. Aber auch die Schlachtfelder der Weltkriege, Verdun, Stalingrad oder weniger bekannte wie Woronesch, wo man noch heute namenlose Opfer beider Seiten aus der Erde gräbt und, wie zerstückelt auch immer, zu bestatten versucht. Da spätestens gewinnt die Kategorie Zeit ein Gewicht, das sich mit Philosophie, Naturwissenschaft oder Religion nicht mehr – oder jedenfalls nicht mehr so ganz einfach – leichter machen lässt.
Am Morgen, am Abend, am Ziel
Zistrosen
Unter der Sonne von Woronesch
Herzlichen Dank, dass Sie mir so lange und so freundlich zugehört haben!
Statt eines allgemeinen Diskussionsangebots, das jetzt vielleicht angebracht wäre, biete ich Ihnen lieber Nachgespräche in gelockerter Formation an, die von einem Glas Wein beflügelt werden.
Lyrik Kommentar
Lyrik Kommentar
